Eine gut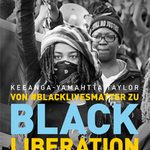 e Rezension zu einem spannenden Buch von kritisch-lesen:
e Rezension zu einem spannenden Buch von kritisch-lesen:
Feministisch, antirassistisch und zutiefst klassenkämpferisch. Klingt nach einer explosiven Mischung? Ist es auch – im besten Sinne des Wortes.
Trotz anderslautendem Titel: Keeanga-Yamahtta Taylors „Von #BlackLivesMatter zu Black Liberation“ ist kein Buch über Black Lives Matter. Oder, genauer gesagt: Es ist weit mehr als das. Auch wenn der Slogan der Bewegung in breiten Lettern auf dem Cover prangt, im Mittelpunkt von Taylors insgesamt acht Kapiteln steht ein viel weitreichenderes Argument, das zwar nicht neu ist, dessen zeitgemäße Reformulierung aber enormen Wert hat: Klassenpolitik und Antirassismus, so Taylors unnachgiebige Grundthese, schließen sich nicht aus. Im Gegenteil: Sie bedingen einander. Obwohl sich Taylor also, und das allein ist mehr als lesenswert, an der Black Lives Matter Bewegung abarbeitet – an ihren historischen Entstehungsbedingungen (von der Sklaverei zum Rassismus des US-amerikanischen Justizsystems), an ihren Vorgängerbewegungen (allen voran den Black Panthers) sowie an ihren gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen (nicht zuletzt die Frage der Selbstorganisation ist zentral) –, geht sie zugleich ein Problem an, das weit über den Themenkomplex „Black Lives Matter“ hinausweist: Die antirassistische und feministische Erneuerung linker Klassenpolitik.
Selbstorganisation: Vom Moment zur Bewegung
Der Weg zu einer solchen Klassenpolitik führt – daran lässt Taylor keinen Zweifel – über das mühsame Geschäft der Selbst- und Basisorganisation. Und genau hier lohnt sich Taylors Blick auf Black Lives Matter ungemein. Mit Empathie, aber keineswegs unkritisch, zeichnet Taylor die Entstehung und schrittweise Verfestigung der Bewegung nach. Einer der tragischen Schlüsselmomente dabei: der Mord an Mike Brown, einem Schwarzen Auszubildenden aus Ferguson, durch den weißen Polizisten Darron Wilson am 9. August 2014. Stellvertretend für die unerträglich lange Liste Schwarzer Todesopfer (Männer, aber auch Frauen), die durch Polizeigewalt ihr Leben verloren, entfachte der Mord an Brown eine der größten Protestwellen der jüngeren amerikanischen Geschichte. „Browns Tod [war] das Ereignis, das nicht nur die Schwarzen Bewohner*innen von Ferguson, sondern Hunderttausende Schwarzer Menschen im ganzen Land sagen ließ: ‚Es reicht!’“ (S. 182). Denn nur wenige Wochen zuvor, am 17. Juli 2014, war es in New York zu einem ähnlichen Exzess weißer Polizeigewalt gekommen. Der Polizist Daniel Pantaleo erwürgte auf offener Straße Eric Garner, einen 43-jährigen Gärtner, und kam – wie Mike Browns Mörder – ohne Anklage davon. Als die Nichtanklage von Pantaleo im November desselben Jahres zur Gewissheit wurde, entzündete sich der Funke des Protests erneut:
„Zehntausende Menschen an verschiedenen Orten der USA bauten Barrikaden, angewidert und entrüstet darüber, dass ein weiterer weißer Polizeibeamter ungestraft damit davongekommen war, den Tod eines unbewaffneten Schwarzen Mannes verursacht zu haben. Die Beweise in diesem Fall waren sonnenklar. Hunderttausende Menschen hatten das Video gesehen, in dem Garner um sein Leben flehte und immer wieder – insgesamt elf Mal – sagte: ‚Ich kriege keine Luft’, I can’t breathe“ (S. 200).
Genau an dieser Stelle setzt Taylor an. Die Frage, die sie an die Bewegung richtet, klingt simpel, ist in der Praxis aber verzwickt: Wie gelangt man von einem flüchtigen Moment des Protests, in dem sich Entrüstung, Empörung, Trauer und Wut spontan entladen, zu einer langfristigen Bewegung? Taylor tut gut daran, zu betonen, dass diese Frage nicht in der Theorie, sondern immer und immer wieder in der Praxis beantwortet werden muss. Aber – und genau hier liegt Taylors wichtiger Beitrag – Theorie ist eben auch ein wichtiges und unumgängliches „Hilfsmittel“ in jedem konkreten Prozess der Selbstorganisation. Die Analyse, die Taylor zu Black Lives Matter anbietet, mag zunächst irritieren, sie ist aber goldrichtig – und lautet in ihrer Kurzform in etwa so: So sehr die jüngsten Ereignisse rassistischer Gewalt in den USA das Augenmerk auf die unübersehbaren und zutiefst gewaltvollen Konsequenzen von Rassismus lenken (Polizeigewalt bis hin zu Morden, racial profiling, überproportionale Inhaftierungsraten von Afroamerikaner*innen), so wichtig ist es, nicht bei diesen Effekten stehen zu bleiben, sondern nach ihren tiefer liegenden Ursachen zu fragen. Mit anderen Worten: Es geht um die gesellschaftlichen Bedingungen, die rassistische Gewalt und Diskriminierung erst ermöglichen und – Taylor redet hier nicht lange um den heißen Brei herum – ihren Ursprung im Kapitalismus und seinen (zutiefst widersprüchlichen) ökonomischen, kulturellen und politischen „Logiken“ haben.
Dementsprechend besteht Taylor darauf, Rassismus nicht nur als kulturelle Diskriminierungsform zu fassen, sondern als eine Ideologie, die auf handfesten ökonomischen Realitäten aufsetzt – auf einer, wie Taylor sie nennt, „politischen Ökonomie des Rassismus“ (S. 241). Es ist diese politische Ökonomie des Rassismus, die sowohl die republikanische als auch die demokratische Partei – inklusive Barack Obama und Hillary Clinton – umschifft haben, wenn sie die Gründe für Schwarze Armut stets auf kultureller Ebene (etwa in Schlagwörtern wie „Schwarzer Kultur“, „Schwarzen Familienstrukturen“ oder „Schwarzem Alltagsleben“) und damit bei den Betroffenen selbst suchten. Aber es ist auch diese politische Ökonomie des Rassismus, die wichtige Ausgangspunkte für eine Praxis der Selbstorganisation bietet, die über ganz verschiedene Diskriminierungsformen hinwegreicht. Am Beispiel von Black Lives Matter bedeutet das, dass die rassistische Unterdrückung von Schwarzen nicht in Abgrenzung von, sondern in Zusammenhang mit dem Leid gewöhnlicher Weißer verhandelt werden muss. Denn – so Taylors nachdrückliches Plädoyer – Erzählungen über die angebliche Einzigartigkeit verschiedener Unterdrückungserfahrungen
„vertiefen die Gräben zwischen Menschen, die eigentlich ein großes Interesse daran hätten, sich zu vereinen. […] Beispielsweise ist die Mehrheit der Menschen, die in den USA in Armut leben, weiß, doch das Gesicht amerikanischer Armut ist praktisch ausschließlich Schwarz. Natürlich sind Afroamerikaner*innen unter den Armen des Landes überrepräsentiert, aber weiße Armut zu ignorieren hilft nur dabei, die systematischen Wurzeln aller Armut zu vertuschen“ (S. 65f).
Ähnlich auch Taylors abschließende Prognose zu Black Lives Matter: Die Bewegung muss solidarische Brücken zu breiteren antikapitalistischen Bündnissen bauen. Taylor nennt etwa den in Solidarität mit Black Lives Matter erfolgten Streik von Hafenarbeiter*innen am 1. Mai 2015 an der amerikanischen Westküste. Nur mit Antikapitalismus wird Black Lives Matter eine Chance haben, nicht durch Staat und Kapital vereinnahmt zu werden. Darin, so Taylor, besteht die eigentliche selbstorganisatorische Herausforderung für die Bewegung.
Selbstorganisation und „neue Klassenpolitik“
Taylors Verknüpfung von Klasse und „Rasse“ ist sicherlich nicht neu. Aber ihr Buch kommt (nicht zuletzt in seiner deutschen Übersetzung) zu einem Zeitpunkt, an dem das konsequente Zusammendenken beider Kategorien besonderen Stellenwert für linksradikale Selbstorganisation hat – ob in den USA oder in Deutschland. So lohnt es sich ungemein, ihre Analyse als Teil einer breiteren Debatte zu lesen, in der es um eine grundlegende Neuausrichtung linker Klassenpolitik geht und die nicht zuletzt von Didier Eribons Verkaufsschlager „Rückkehr nach Reims“ (siehe Rezension in Ausgabe 41) auf den Punkt gebracht wurde. Im Kern geht es um die Frage, ob die Linke in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten die Arbeiterklasse vernachlässigt hat und, falls ja, wie eine Klassenpolitik auf Höhe der Zeit dann aussehen müsste.
Die Frage kommt nicht von ungefähr. Denn mit dem sogenannten „cultural turn“ haben seit den 1970er Jahren verstärkt Theorien das Zepter linken Denkens in die Hand genommen, für die es (berechtigterweise) darum ging, den Marxismus der alten Garde (à la Haupt- und Nebenwiderspruch) und damit auch die Kernkategorie „Klasse“ in die Schranken zu weisen. Resultat: Nach und nach bildeten sich – sicherlich vereinfacht gesprochen, aber trotzdem nicht von der Hand zu weisen – zwei grobe „Lager“ heraus: marxistisch orientierte Ansätze auf der einen, intersektionale und poststrukturalistische (oft feministisch, queer oder postkolonial orientierte) Ansätze auf der anderen Seite. Was Taylors Buch vom mäßig aufschlussreichen Allerlei anderer Analysen abhebt, ist dass es diese zwei Pole selbst in Frage stellt. An ihre Stelle setzt sie das, was der cultural turn relativ „erfolgreich“ aus den Köpfen vieler Linker gespült zu haben scheint – die Systemfrage:
„Angesichts der Popularität des Sozialismus (in der einen oder anderen Auslegung) während der letzten Welle Schwarzer Rebellion, mutet es seltsam an, wie leichtfertig der Sozialismus heute als Möglichkeit, Rassismus und Schwarze Unterdrückung zu erklären, verworfen wird“ (S. 234).
Hier liefert Taylor dringend benötigte Argumente. Geduldig und mit entwaffnender analytischer Schärfe zeigt sie, dass eine erneuerte, explizit feministische und antirassistische Klassenpolitik Ausgangspunkt radikaler Selbstorganisierung sein kann und, in letzter Instanz, auch sein muss. Die entsprechende Gegenfrage – ist es möglich, „Klasse“ stärker in den Vordergrund linksradikaler Selbstorganisation zu rücken ohne dabei reaktionären Ressentiments gegenüber den feministischen, sexualpolitischen und antirassistischen Errungenschaften seit `68 zu verfallen? – beantwortet sie mit einem nachdrücklichen (aber keineswegs unüberlegten) „Ja, natürlich!“ Bestes Beispiel: Der entschlossene Antikapitalismus der Black Panthers.
Die Idee, dass Klassenpolitik – und mit ihr Begriffe wie „Ausbeutung“, „Mehrwert“ oder eben auch „Klassenkampf“ – zwangsweise weiß und männlich seien und daher keinen Beitrag zur radikalen Aufdeckung und Überwindung rassistischer und anderer Ungleichheiten leisten könnten, weist Taylor entschieden zurück:
„Keine ernstzunehmende sozialistische Strömung der letzten hundert Jahre hat je verlangt, die Kämpfe von Afroamerikaner*innen oder Latinos/Latinas beiseite zu schieben, um andere Klassenkämpfe zuerst zu führen. Diese Vorstellung beruht auf der falschen Idee, dass die Arbeiterklasse weiß und männlich und daher unfähig sei, sich den Fragen von ‚Rasse’, ‚Klasse’ und ‚Geschlecht’ anzunehmen. Tatsächlich ist die amerikanische Arbeiterklasse weiblich, migrantisch, Schwarz, weiß, Latino/Latina und vieles mehr. Migration, Geschlecht und Antirassismus sind Fragen der Arbeiterklasse“ (S. 253).
Zusammenfassend lässt sich Taylors Anliegen vielleicht am besten damit beschreiben, „Klasse“ wieder zu jenem gemeinsamen Ausgangspunkt zu machen, der – trotz aller vorhandenen und von staatlicher Seite aktiv geförderten Spaltungen (etwa zwischen weißen und Schwarzen Arbeiter*innen, Muslim*innen, Latinos und Latinas, LGBTQ-Personen, Indigenen, Migrant*innen, Studierenden und so weiter) – eine radikale (weil breitenwirksame) Selbstorganisation erst möglich macht. Bei ihr klingt das dann etwa so:
„Wenn wir vor allem die Unterschiede zwischen den Formen von Unterdrückung, die einzelne Gruppen betreffen, betonen, verlieren wir irgendwann das Verständnis dafür, dass wir aufgrund der gemeinsamen Unterdrückung auch miteinander verbunden sind. Diese Verbindung muss die Basis unserer Solidarität sein. Es gibt keinen Grund, Marginalisierung zu zelebrieren“ (S. 220).
Es sind Zeilen wie diese, die Taylors Buch so wertvoll machen und die an einen sehr schlauen – und noch dazu sehr schönen – Satz erinnern, den der marxistische Geograph Kanishka Goonewardena vor nicht allzu langer Zeit zu Papier brachte: „Man darf den Marxismus nicht den Dummköpfen überlassen; dafür ist er zu wichtig“ (Goonewardena 2015, S. 106). Ja, es braucht den Marxismus – den der schlauen, radikalen, feinfühligen Sorte; und mit ihm eine selbstorganisatorische Praxis, die die falsche Gegenüberstellung von Klasse auf der einen und „Rasse“, Geschlecht und Sexualität auf der anderen Seite strikt zurückweist. Nichts anderes bietet Taylor – von der ersten bis zur letzten Seite.
Zusätzlich verwendete Literatur
Goonewardena, Kanishka (2015): Vom Antikolonialismus zu globalen Gebeten ohne Marx. Über die Ungewöhnlichkeit der sogenannten Postkolonialisierung. sub\urban 3: 1, S. 103-110. Online einsehbar hier.
